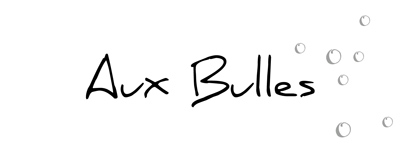Champagner und die Bedeutung der Hefe
Hefe (Saccharomyces cerevisiae) spielt in der Champagner Herstellung eine zentrale Rolle, denn ohne sie entsteht aus Most weder ein Grundwein, noch erfolgt die prise de mousse (dt. Kohlensäurebildung) in der Flasche. Der Ursprung der Hefen (ob indigen im Most oder aus Reinzucht) und die Art der Fermentierung (ob spotan oder durch Hefezusatz) wird daher kritisch diskutiert.
Mythos 1: Hefe ist typisch für ein bestimmtes Terroir
Weingärten zeichnen sich durch eine einzigartige Flora aus. Aus zahlreichen Studien geht jedoch hervor, dass die für die alkoholische Gärung erforderliche Hefe auf den Trauben kaum oder gar nicht vorhanden ist. Der Großteil der im Most indigenen Hefebakterien stammt stattdessen vom Werkzeug der Weinkellerei (d.h. Presse, Holzfässer, Tanks, Pumpen, usw.) und pflanzt sich dort von Jahrgang zu Jahrgang fort. Saccharomyces cerevisiae hat ihren Ursprung in Mesopotamien, durch die Anpassung an eine Vielzahl an verschiedener klimatischer Bedingungen gibt es heute jedoch unzählige genetische Variationen dieser Bakterien. Eine Studie aus Bordeaux zeigt, dass dort eine große genetische Vielfalt von Saccharomyces cerevisiae vorherrscht, es gibt also keinen typischen Hefestamm für diese Weinregion.
Mythos 2: Spontanvergärung macht den besseren Wein
Damit die alkoholische Gärung beginnen kann, muss eine Schwelle von ca. 1 Million Hefebakterien je mL überschritten werden. Bei Most liegt die anfängliche Hefe Population bei ca. 100-1000 Hefen je mL. Ohne Hefezusatz müssen sich die im Most vorkommenden, indigenen Hefen daher so lange vermehren bis ein dominanter Stamm den Schwellwert erreicht. Dieser Prozess nimmt typischerweise 10 Tage in Anspruch. Diese Verzögerungsphase erhöht das Risiko, dass sich Mikroorganismen ansiedeln, welche die Qualität des Weins beeinträchtigen (z.B. Schimmel-, oder Essigsäurebakterien). Einige indigene Hefestämme sind zudem nicht in der Lage, die Gärung vollständig zu beenden, oder können erhebliche Mengen an Schwefel oder flüchtiger Säure produzieren. Zusätzlich dazu ist der Most durch die fehlende Freisetzung von Gär-CO2 während dieser 10 Tage nicht vor Sauerstoff geschützt. Bei Hefezusatz hingegen wird dem Most sofort 1-3 Millionen Hefebakterien pro mL zugeführt, wodurch die alkoholische Gärung zeitnahe startet. Spontane alkoholische Gärung ist daher riskanter, denn alles hängt vom Hefestamm ab der sich durchsetzt.
Mythos 3: Reinzuchthefen werden synthetisch hergestellt
Das CIVC leitete in den 80er Jahren ein umfangreiches Auswahlverfahren ein, das zur Einführung eines Präparats aus Trockenhefe führte. Zunächst wurden zahlreiche Moste aus verschiedenen Presszentren der Region gesammelt. Nach erfolgter alkoholischer Gärung wurde der dominante Hefestamm isoliert. So entstand eine Sammlung von fast 600 regionstypischen Hefestämmen. Im zweiten Schritt wurde die Leistung dieser Stämme überprüft und es wurden fünf Hefestämme ausgewählt, die eine sichere alkoholische Gärung gewährleisten ohne den Wein zu verfälschen.

Aux Bulles Chanpagnerabo - Hefe